Motion SP-Juso-PFG-Fraktion: «Vereinbarkeit von Beruf Familie, Frauen in Kader- und Führungspositionen» |
Gedanken zur Abstimmung |
Am 28. Februar stimmt das St.Galler Stimmvolk über die Güterbahnhofinitiative ab.
Wir sollen uns zwischen „Staustadt - Nein Danke“ und „Stadtentwicklung jetzt“ entscheiden.
Als bekennende Städterin und Anwohnerin des Riethüsliquartiers hätte ich gerne den Fünfer und das Weggli.Auch ich wünsche mir eine Verkehrsberuhigung in meinem Wohnquartier und gleichzeitig liegt mir die Entwicklung einer der letzten innerstädtischen Baulandreserven am Herzen.
Ob ein weiterer Autobahnzubringer in einem zentralen urbanen Entwicklungsgebiet die Antwort auf unser gesteigertes Mobiliätsbedürfnis sein kann, wage ich allerdings zu bezweifeln. Eine optimale Erschliessung der Metropolitanregion St.Gallen ist wirtschaftlich nötig und sinnvoll, was auch den Bau einer 3. Autobahnröhre rechtfertigt. Der teure Kapazitätsausbau der Stadtautobahn hingegen schafft nicht nur falsche Mobilitätsanreize, sondern löst auch das Problem der verstopfen Innenstadtzubringer nicht. Solange Nahpendler und Hangbewohner auf einen Parkplatz in der Innenstadt spekulieren, werden wir die Staustadt nicht los. Eine konsequente Optimierung im ÖV sowie attraktive E-Bike Routen oder flexiblere Arbeitszeitmodelle um die Spitzenbelastung der Zubringerstrassen zu brechen sind für mich innovativere Modelle.
Innovativ wäre auch das Güterbahnhofareal möglichst bald, wie es Basel mit dem Erlenmattquartier vorgemacht hat, zu einem 2000 Watt Areal zu entwickeln. Wohnen und Arbeiten in einem attraktiven Quartier mit allerbester ÖV-Anbindung, einem Naherholungsgebiet auf der Kreuzbleiche und einer direkten Verbindung zum Quartier Bahnhof Nord wäre eine visionäre Nutzung für die Energiestadt St.Gallen. Nun soll jeder selber entscheiden, ob zwei Autobahnspuren, die neben der Gartenlaube im Güterbahnhofquartier im Boden verschwinden und noch mehr Verkehr in der Innenstadt Lust auf städtisches Wohnen machen.
Wir sollen uns zwischen „Staustadt - Nein Danke“ und „Stadtentwicklung jetzt“ entscheiden.
Als bekennende Städterin und Anwohnerin des Riethüsliquartiers hätte ich gerne den Fünfer und das Weggli.Auch ich wünsche mir eine Verkehrsberuhigung in meinem Wohnquartier und gleichzeitig liegt mir die Entwicklung einer der letzten innerstädtischen Baulandreserven am Herzen.
Ob ein weiterer Autobahnzubringer in einem zentralen urbanen Entwicklungsgebiet die Antwort auf unser gesteigertes Mobiliätsbedürfnis sein kann, wage ich allerdings zu bezweifeln. Eine optimale Erschliessung der Metropolitanregion St.Gallen ist wirtschaftlich nötig und sinnvoll, was auch den Bau einer 3. Autobahnröhre rechtfertigt. Der teure Kapazitätsausbau der Stadtautobahn hingegen schafft nicht nur falsche Mobilitätsanreize, sondern löst auch das Problem der verstopfen Innenstadtzubringer nicht. Solange Nahpendler und Hangbewohner auf einen Parkplatz in der Innenstadt spekulieren, werden wir die Staustadt nicht los. Eine konsequente Optimierung im ÖV sowie attraktive E-Bike Routen oder flexiblere Arbeitszeitmodelle um die Spitzenbelastung der Zubringerstrassen zu brechen sind für mich innovativere Modelle.
Innovativ wäre auch das Güterbahnhofareal möglichst bald, wie es Basel mit dem Erlenmattquartier vorgemacht hat, zu einem 2000 Watt Areal zu entwickeln. Wohnen und Arbeiten in einem attraktiven Quartier mit allerbester ÖV-Anbindung, einem Naherholungsgebiet auf der Kreuzbleiche und einer direkten Verbindung zum Quartier Bahnhof Nord wäre eine visionäre Nutzung für die Energiestadt St.Gallen. Nun soll jeder selber entscheiden, ob zwei Autobahnspuren, die neben der Gartenlaube im Güterbahnhofquartier im Boden verschwinden und noch mehr Verkehr in der Innenstadt Lust auf städtisches Wohnen machen.
Urbane Lebensräume neu entdeckt
Gestalte das Bookcover Deines politischen Bestsellers.
So lautete die Aufgabenstellung des Frauennetz Gossau.
Eine wunderbar kreative und abwechslungreiche Methode um siebzehn ambitionierte Kantonsratskandidatinnen vorzustellen.
Hier das Rezept für meinen DIY-Bestseller:
Eine wunderbar kreative und abwechslungreiche Methode um siebzehn ambitionierte Kantonsratskandidatinnen vorzustellen.
Hier das Rezept für meinen DIY-Bestseller:
Format | Klarer Fall, ein E-Book oder noch lieber ein Blog sollte es sein. Ich suche den Dialog: gerne prägnat, knackig und unmittelbar. Schon als Kind habe ich lieber Zeitungen oder Magazine verschlungen. Für Romane bin ich definitiv zu ungeduldig. Zudem sind für mich auch Bilder wichtige Informationsquellen, die auf sehr direkte Art Emotionen wecken. Das Wichtigste am Blog-Format ist aber die Interaktion. Wählerinnen und Wähler sollen liken, teilen, kommentieren und natürlich auch kritisieren können, denn Politik ist für mich ein Dialog und keine Einbahnstrasse. |
Titel | "dEine Reporterin von "RadioTop" hat mich in einem Interview gebeten die Grünliberale Partei (glp) mit einem Tier zu beschreiben. Der Stadtfuchs beschreibt nicht nur die glp, sondern auch meine Persönlichkeit sehr treffend. Die glp versucht innovative Lösungsansätze für Urbanisierungsherausforderungen wie Migration oder Zersiedelung zu bieten. Auf die Reviererweiterung des Stadtfuchs reagieren wir mit einer Verhaltensänderung. Ein abgedeckter Kompost oder den Abfallsack am richtigen Wochentag vor der Tür zu stellen, bringt weit mehr als der Versuch den Fuchs wieder aus der Stadt zu vertreiben. Ganz ähnlich sollten wir uns zum Beispiel im Bereich der Mobilität verhalten. Gegen Staus in Wohnquartieren ist die Anpassung von Arbeitszeitmodellen zur Brechung der Pendlerspitzen vielleicht die schlauere und innovativere Lösung als der Ausbau von Strassen für den motorisierten Individualverkehr. |
Inhalt | Auf der Rückseite meines E-Books findet der interessierte Leser oder die interessierte Leserin meine politischen Schwerpunktthemen. Auch hier nicht als Klappentext, sondern gleich prägnat und informativ in Form einer Inhaltsangabe. |
Design | Natürlich isst auch das Auge mit! Als Cover hab ich ein Stadtfuchs-Graffiti gewählt. Urban, modern, frech und doch charmant. Und Selbstverständlich darf auch unser glp Wahlslogan nicht fehlen. |
Krachnuss 7: Keine unnötige Aufblähung der Krankenkassensubventionen – Nein am 15. November 2015!
8/11/2015
Eine Pflästerlipolitik im Bereich der Krankenkassensubventionierung kann das eigentliche Problem der stetig steigenden Gesundheitskosten nicht lösen.
Jacqueline Gasser-Beck, Co-Präsidentin glp Kanton St. Gallen
Die Grünliberale Partei des Kantons St.Gallen empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern die Prämienverbilligungsinitiative zur Ablehnung. Einerseits weil wir der Meinung sind, dass die aktuellen Kantonsfinanzen keine zusätzliche Ausfinanzierung sozialstaatlicher Leistungen erlauben und andererseits weil wir überzeugt sind, dass diejenigen Bürgerinnen und Bürger, welche auf eine Entlastung in der Haushaltskasse für Krankenkassenprämien angewiesen sind auch weiterhin nicht auf eine Prämienverbilligung verzichten müssen.
Der Kanton St.Gallen bewegt sich, trotz einem massiven Prämienanstieg in der letzten Jahren, im gesamtschweizerischen Kontext noch immer im Mittelfeld. So verhält es sich auch mit dem Volumen der zur Verfügung gestellten Mittel für die individuelle Prämienverbilligung (IPV). Mit einem Kantonsbeitrag von 28.2 Prozent des Prämienverbilligungsvolumens (Bundes- und Kantonsbeitrag) liegt der Kanton St.Gallen nahe am gesamtschweizerischen Durchschnitt von derzeit 29.0 Prozent. Eine Steigerung auf einen Kantonsbeitrag auf 48 Prozent, wie es die Initianten vorsehen, wäre klar überproportional und soll deshalb in der momentanen Finanzlage des Kantons „nicht ohne Not“ forciert werden.
Nun stellt sich die Frage, ob die Situation, wie sie sich derzeit darstellt, tatsächlich eine Notsituation ist. Es ist zwar richtig, dass sich die Anzahl der ordentlichen Prämienverbilligungsbezüger zu Lasten der Ergänzungsleistungs- oder Sozialhilfebezüger reduziert hat, aber der mit der Einführung der IPV im Jahre 1996 angestrebte Umverteilungseffekt ist noch immer gewährleistet. Nach wie vor profitieren Einelternhaushalte und Haushalte mit mehreren Kindern, die mit einem bescheidenen Einkommen auskommen müssen und mit einer Pro-Kopf-Prämie verhältnismässig stärker belastet sind, am Meisten.
Ein Nein zur Prämienverbilligungsinitiative kann deshalb nicht per se als unsozial bezeichnet werden, sondern hilft mit den eingeschlagen Weg zur Gesundung der Kantonsfinanzen mit zu tragen.
Meine Stellungnahme an der Pressekonferenz vom 26.Oktober 2015 zur Abstimmung vom 15. November 2016 über die Beschränkung des Pendelerabzugs. #zersiedelung stoppen
Weitere Infos unter: www.pendlerabzug-ja.ch
Weitere Infos unter: www.pendlerabzug-ja.ch
#wahlCH15 - letzer Akt: Nachwahlsendung @srf - Danke @Frauenetz Gossau! Politik kann auch glücklich machen :-)
Posted by Jacqueline Gasser-Beck, glp Kanton St.Gallen on Dienstag, 20. Oktober 2015
Autorin
Jacqueline Gasser-Beck
glp Politikerin
DIY-Freak
Archiv
Oktober 2019
September 2019
Dezember 2018
Juli 2018
Oktober 2016
Juni 2016
Mai 2016
Februar 2016
November 2015
Oktober 2015
August 2015
Juli 2015
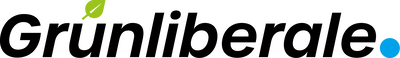





 RSS-Feed
RSS-Feed
